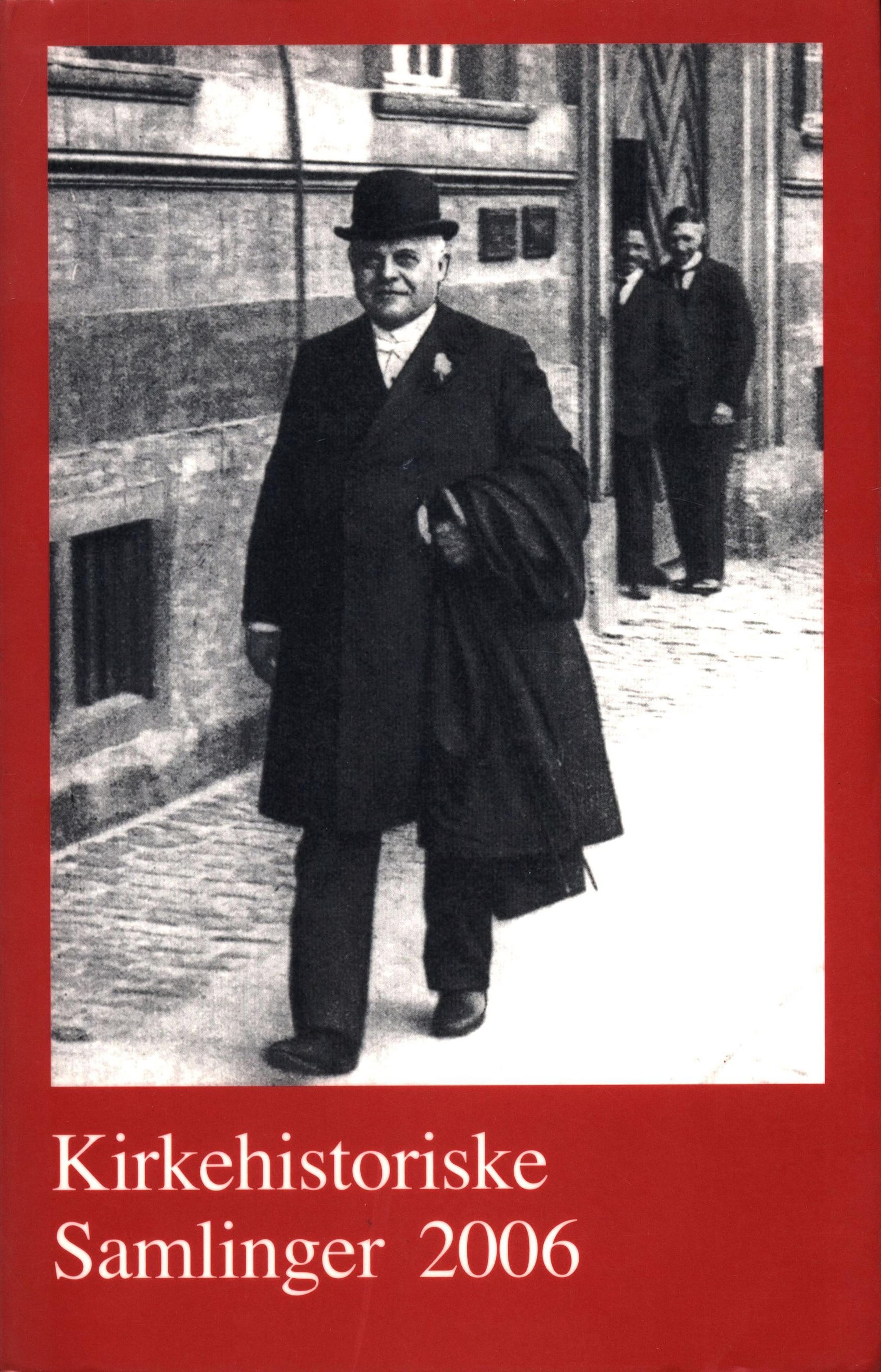Publiceret 15.12.2006
Citation/Eksport
Copyright (c) 2024 Tidsskriftet Kirkehistoriske Samlinger

Dette værk er under følgende licens Creative Commons Navngivelse – Ingen bearbejdelser (by-nd).
Resumé
Als die Liberalen (Venstre) 1901 die Wahlen zum Folketing gewonnen hatten und die Regierung bilden konnten, leitete J.C. Christensen seine Zeit als Kirchenminister ein mit der Vorlage einer Reihe von wesentlichen Kirchengesetzen, die den Mitgliedern der Volkskirche Einfluss auf interne kirchliche Angelegenheiten geben sollten, mit dem Ziel, ihr Interesse für diese Angelegenheiten zu fördern. Als die Liberalen 1920 die Regierungsmacht wieder gewonnen hatten, könnte man glauben, dass J. C. seine Tätigkeit als Minister in der gleichen Weise beschließen möchte, indem er für die Durchführung einer Reihe von weitgehenden Kirchengesetzen sorgte, die den Kirchengemeinden noch mehr Einfluss gaben. Aber so war das nicht. Als J.C. voraussehen konnte, dass die Liberalen bei der Wahl zum Folketing am 5.5.1920 wieder die Regierungsmacht übernehmen würden, schrieb er im Voraus an Niels Neergaard, den Wirtschaftsexperten der Partei, und forderte ihn auf, die Bildung einer neuen Regierung auf sich zu nehmen, die aus etwas jüngeren Ministern bestehen sollte. Für diese Aufgabe fühlte J.C. sich als eine in der Politik zu umstrittene Person. Er sah wahrscheinlich auch voraus, dass man, wenn die Restriktionen der Kriegszeit allmählich aufgehoben würden, einen Wirtschaftsfachmann an der Spitze der Regierung brauchte. Außerdem wären die Liberalen auf die Unterstützung der konservativen Volkspartei angewiesen, und eine Voraussetzung dafür wäre, dass diese Partei nur einen geringen Einfluss auf die Politik der Regierung gewinnen dürfte. So war die Lage Anfang der zwanziger Jahre. J.C. hätte keine Lust, diesen Kampf zu führen, noch die nötigen Kräfte dafür. Neergaard wies aber mehrmals die Aufforderung zurück, denn für ihn stand es fest, dass J.C. unbedingt Chef der Regierung werden sollte, eine andere Lösung sei unmöglich. J.C. blieb aber fest bei seinem Vorschlag, und schließlich gab Neergaard nach, aber nur unter der Voraussetzung, dass J.C. Mitglied der Regierung werden sollte, denn ohne ihn würden sie geschwächt dastehen. J.C. willigte schließlich ein, hob aber sein Interesse an der Durchführung einiger Gesetzes-vorlagen bezüglich der kirchlichen Verhältnisse in Nordschleswig hervor. Nordschleswig war der nördliche Teil der Herzogtümer, die Dänemark nach dem Krieg 1864 an Preußen hatte abtreten müssen, dessen Bevölkerung aber bei der Volksabstimmung nach dem Friedensschluss für Dänemark gestimmt hatte. Unter der preußischen Verwaltung hatte sich der Landesteil auf kirchlichem Gebiet in eine etwas andere Richtung entwickelt als Dänemark; die Nordschleswiger wünschten sich nun eine Annäherung an dänische Verhältnisse, wenn auch mit Berücksichtigung ihrer besonderen Entwicklung. Deshalb schlug J.C. vor, dass ein kirchlicher Ausschuss gebildet werden sollte, der unter Teilnahme gewählter Vertreter der Bevölkerung Nordschleswigs und Vertreter der Kirche aus dem alten Dänemark Vorschläge zu einer Ordnung machen sollte, die die sehr unterschiedlichen kirchlichen Verhältnisse berücksichtigte, die es seit 1864 südlich und nördlich der Grenze gab. Südlich der Grenze war der örtliche Einfluss auf die Kirche größer. Die Kirche hatte hier das Recht der Gemeinden behalten, den zu den Pfarrhäusern gehörigen, oft recht großen Grundbesitz zu besitzen und zu verwalten, während der kirchliche Grundbesitz in Dänemark im Jahre 1919 per Gesetz überwiegend zur Parzellierung freigegeben worden war. Die Finanzen der Kirche waren auch durch die sozialliberale Regierung zentralisiert worden. Die Gesetzesvorlage über den kirchlichen Ausschuss stieß sowohl bei den Sozialisten als auch bei den Vertretern der Sozialliberalen auf Widerstand. Sie hatten den Verdacht, dass J.C. hierdurch die Entwicklung der Kirchenverfassung weiter betreiben wollte, die er 1901 als Endziel der Kirche aufgestellt hatte. Dies könnte geschehen, wenn das Gesetz den Minister ermächtigte, andere Themen als die im Gesetz angegebenen aufzugreifen. J.C. erwähnte in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Ausschusses, was vor allem Gegenstand der Arbeit des Ausschusses sein sollte: die Wahl der Vertreter der Kirchengemeinden und deren Verantwortung für Kirche und Friedhof, sowie eine freiere Wahl der Pfarrer und eine Regelung für die Gehälter der Pfarrer. Der Ausschuss sollte seine Arbeit zum 31.12.1921 beenden, was an sich bedeuten würde, dass nur Verhältnisse, die eng mit den Gemeinden verbunden waren, behandelt werden könnten, und nicht etwa eine von oben gesteuerte Beaufsichtigung der Kirche. Am 16.2.1921, dem Tag, an dem die Arbeit des Ausschusses
veröffentlicht wurde, legte J.C. 9 kirchliche Gesetzesvorschläge vor, deren Inhalt in mancher Hinsicht davon geprägt war, dass sie ein Werk des Ausschusses waren. Die Kirchenvorstände bekamen hier das Recht zur Teilnahme an der Wahl des Pfarrers. Früher hatten die Kirchenvorstände in Nordschleswig zwischen 3 Kandidaten wählen können, die ihnen von der Obrigkeit mitgeteilt wurden. Die neuen Kirchenvorstände bekamen auch die Verantwortung für die Finanzen der Kirche und die Aufsicht über sie, den Friedhof, den Pfarrhof und über die Nutzung des dazugehörigen Bodens. In Nordschleswig konnte Grundbesitz bei Parzellierung verpachtet, nicht aber verkauft werden. Die Kirchenvorstände bekamen das Recht, 2 Laienmitglieder für den Probsteiausschuss zu wählen, dessen Aufgabe es war, mit dem Probst als Vorsitzendem die Ausführung der den Vorständen übertragenen Aufgaben zu beaufsichtigen. Diese Bestimmung rief Proteste der Opposition hervor, denn dadurch wurde eine ganz unnötige finanzielle Kirchenverfassung aufgebaut. Die Kirchenvorstände wurden auch berechtigt, an der Wahl des Bischofs des Bistums teilzunehmen. Die Opposition hatte die Bischöfe zu Staatsbeamten gemacht, die die Aufsicht über die Pfarrer als deren geistliche Vorgesetzte führen sollten. 1912 hatte es Einigkeit in Bezug auf das Kirchenvorstandsgesetz gegeben; nun bekamen sie Aufgaben, die die Gemeindegrenzen überschritten, und somit war es ein Schritt in Richtung einer Kirchenverfassung. Die Vorlage des Gesetzesvorschlags zur Bischofswahl veranlasste
den Sozialdemokraten Fr. Borgbjerg, eine Tagesordnung einzubringen, die zum Inhalt hatte, die Behandlung der Gesetze einzustellen und statt dessen einen Ausschuss damit zu beauftragen, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu behandeln. Dies wollten die Sozialliberalen nicht, denn sie meinten, dass man Nordschleswig zu diesem Zeitpunkt eine kirchliche Ordnung schuldete, die nicht von einer eventuellen Trennung von Staat und Kirche gestoppt werden sollte. Der Sprecher der Konservativen, Professor Oskar Andersen, hatte die Vollmacht seiner Partei zu einer Stellungnahme bekommen. Die Trennung sei ihm 1916 als eine Möglichkeit erschienen, sagte er, jetzt drehe es sich aber darum, die Durchführung der kirchlichen Vorschläge zu sichern, denn sie bedeuteten Fortschritt. Sonst wäre er »allzeit bereit«, das Verhältnis Staat - Kirche zu erörtern. Ein anderes Problem war, dass gefordert wurde, dass man sich für die kirchliche Wählerliste zur Wahl des Kirchenvorstandes anmelden sollte. Es sollte ganz einfach sein; eine einmalige Anmeldung, schriftlich oder mündlich, genügte. Bei den eifrigsten Grundtvigianem und bei den Sozialisten rief dies Widerstand hervor. Bei einigen großen grundtvigianischen Versammlungen forderte man freie Teilnahme an jeder Wahl ohne Anmeldung; das gleiche verlangten einige Kopenhagener Pastoren. Es gab wenige Wähler in den großen Gemeinden in der Hauptstadt; man sollte die Mitglieder der dänischen Volkskirche ernst nehmen und ihnen ein freies Wahlrecht zustehen. Aber J.C. war entschieden dagegen. Wenn das die Bedingung für die Verwirklichung der Gesetze sein sollte, so sagte er auf einem Parteitreffen, dann würde er zurücktreten, denn man werde nicht als Mitglied der Kirche geboren, so wie man als Mitglied der Gesellschaft geboren werde. Die Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark machte die Errichtung eines neuen Bistums für diesen Landesteil notwendig. Bei dem übergroßen seeländischen Bistum mit Sitz in Kopenhagen, das man schon 1904 vergeblich zu teilen versucht hatte, musste nun die Teilung stattfinden; für eine Person war die bischöfliche Aufsicht nicht zu bewältigen. J.C. schlug ein neues Bistum für Seeland mit Sitz in Roskilde vor. Der Kopenhagener Bischof sollte die Hauptstadt, Nordseeland, Bornholm, die Färöer und Grönland behalten. Diese Lösung würde Kosten in Höhe von ungefähr 30.000 Kronen bedeuten. Die Zeiten waren finanziell angespannt, man musste sparen. Aus diesem Grunde schlug der Sprecher der Liberalen zusammen mit anderen Vertretern dieser Partei vor, dass das kleine Bistum Lolland-Falster aufgelöst und in das neue seeländische Bistum eingefügt werden sollte. J.C. war entschieden dagegen, denn man konnte nicht zwischen der 2. und 3. Behandlung ein Bistum auflösen, ohne die Betroffenen zu Worte kommen zu lassen. Mit den Stimmen der Opposition wurde aber der Vorschlag angenommen, während alle anderen Vorschläge etwa in der vorgeschlagenen Form beschlossen wurden - außer dem Vorschlag, der sich um die zwei neuen Bistümer drehte. J.C. war erbittert. Könnte man darin einige Anzeichen dafür sehen, dass Moltesen und andere Vertreter der Liberalen eine politische Annäherung an die Sozial-liberalen suchten? Aber das Landsting wies den Gesetzesvorschlag in der Formulierung von J.C. zur abschließenden Behandlung zum Folketing zurück. Dort hatten einige Vertreter der Liberalen ihre Meinung geändert und waren für die Errichtung der zwei neuen Bistümer; es reichte aber noch nicht für eine Mehrheit. Entscheidend wurde, dass bei der Abstimmung 6 sozialdemokratische Abgeordnete mit dem Vorsitzenden an der Spitze im Urlaub waren (anlässlich eines Kongresses?); drei weitere Mitglieder waren einfach abwesend. Damit war aber die Mehrheit für die Auflösung des kleinen Bistums Lolland-Falster verschwunden. Die letzte Abstimmung fand in der ersten Aprilhälfte statt. Am 15. August trat J.C. als Kirchenminister zurück, und Jacob Appel übernahm das Ministerium. Er wurde damit der erste Kirchenminister, der das Gesetz zur Bischofswahl in die Wirklichkeit umsetzen sollte. Die ersten Bischöfe sollten Anfang des Jahres 1923 gewählt werden, und man befand sich nun in der besonderen Lage, dass innerhalb kurzer Zeit fünf neue Bischöfe gewählt und ernannt werden sollten. Das neue Gesetz enthielt die Bestimmung, dass wenn ein Kandidat eine Zweidrittel-Mehrheit erreichte, der Minister verpflichtet war, diesen zu ernennen. Bei keinem der fünf Wahlgänge erreichte ein Kandidat diese Zweidrittel-Mehrheit. Jacob Appel folgte aber dem Rat des sozial-liberalen Kirchenpolitikers Th. Poulsen und ernannte nach jeder Wahl den Kandidaten, der die meisten Stimmen bekommen hatte. Dadurch wurde eine Tradition begründet, die man seitdem weitergeführt hat.