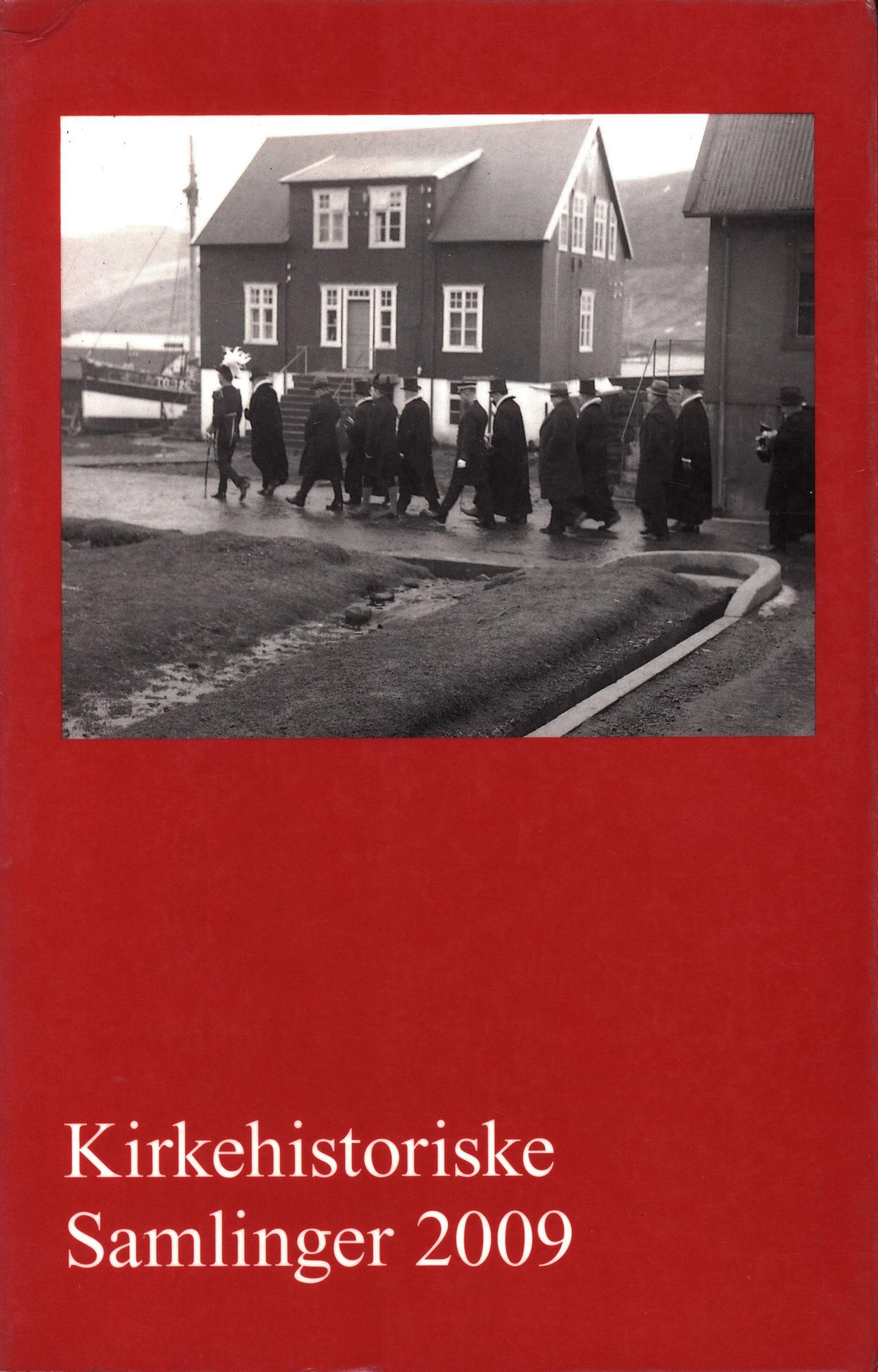Publiceret 15.12.2009
Citation/Eksport
Copyright (c) 2024 Tidsskriftet Kirkehistoriske Samlinger

Dette værk er under følgende licens Creative Commons Navngivelse – Ingen bearbejdelser (by-nd).
Resumé
Eine antijesuitische Schrift aus dem Jahre 1584, ihre Quellen und ein Nachspiel
In der umfassenden Forschung über die jesuitische Infiltration in Skandinavien im Reformationsjahrhundert und Gegenschläge von Seiten der lutherischen Kirche in Dänemark wurde eine kleine Schrift des dänischen Propsts und Kirchenliederdichters Hans Christensen Sthen (1544-1610) bisher nicht erwähnt geschweige denn analysiert. Es dreht sich um eine Auslegung in Frage und Antwort des ersten Psalm Davids mit dem Titel Saligheds Vey (Der Weg zur Seligkeit) 1584 in Kopenhagen gedruckt. Die Gottlosen im Psalm werden besonders als der römische Papst und Antichrist und seine Anhänger, das neue schädliche, vergiftete, jesuitische Unkraut verstanden, das die arme Jugend mit List verführt und die weltlichen Machthaber gegen unsere christliche Religion aufhetzt. Saligheds Vey ist Sthens einzige antikatholische und antijesuitische Schrift. Sonst besteht seine Verfasserschaft, die bald in einer kritischen Gesamtausgabe vorliegen wird, aus Gebetbüchern, Kirchenliedern, Trostschriften und weiterer Erbauungsliteratur. Ein früher Verdacht, Saligheds Vey sei eine Übersetzung, ist jetzt bestätigt. Der ursprüngliche Verfasser ist der flacianische Theologe, Magister Josua Opitius (1542-1585), der als Superintendent in Regensburg und in den Jahren 1574-78 in Wien als Prediger mit grossem Erfolg tätig war, bis er von den Jesuiten und vom Kaiser Rudolph II vertrieben wurde. Zuletzt war er als Pfarrer in Büdingen in der Grafschaft Isenburg in Hessen tätig. Der Titel seiner Schrift ist Der erste Psalm Dauids, kurtz vnd einfaltig durch Frage vnd Antwort erkläret vnd aussgelegt, Basel 1582. Exemplare sind in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel und in der Bayerischen Staatsbibliothek in München erhalten. Saligheds Vey ist eine treue Übersetzung, nur im Vorwort und zum Schluss hat Sthen mit eigenen und Beiträgen anderer den Umfang beträchtlich erweitert. So hat er auch hier wie in früheren Schriften wichtige Anleihen aus Nicolaus Selneckers Der gantze Psalter Dauids, Leipzig 1571 gemacht. Rätselhaft ist, dass der dänische Herausgeber und Übersetzer dieser antijesuitischen Schrift am Ende des Jahrhunderts drei seiner Söhne nach dem jesuitischen Seminarium in Braunsberg in Preussen schickte, wo zwei von ihnen päpstliche Alumnen werden. Die wahrscheinlichste Erklärung dieser entgegengesetzten Handlungen ist die Lage des damaligen schlechten Schulwesens in Dänemark: Sthen hat für seine Söhne den besten Unterricht gesucht und hat sie, vermutlich mit Bedauern, bei den Jesuiten gefunden.